Somatische Gentherapie
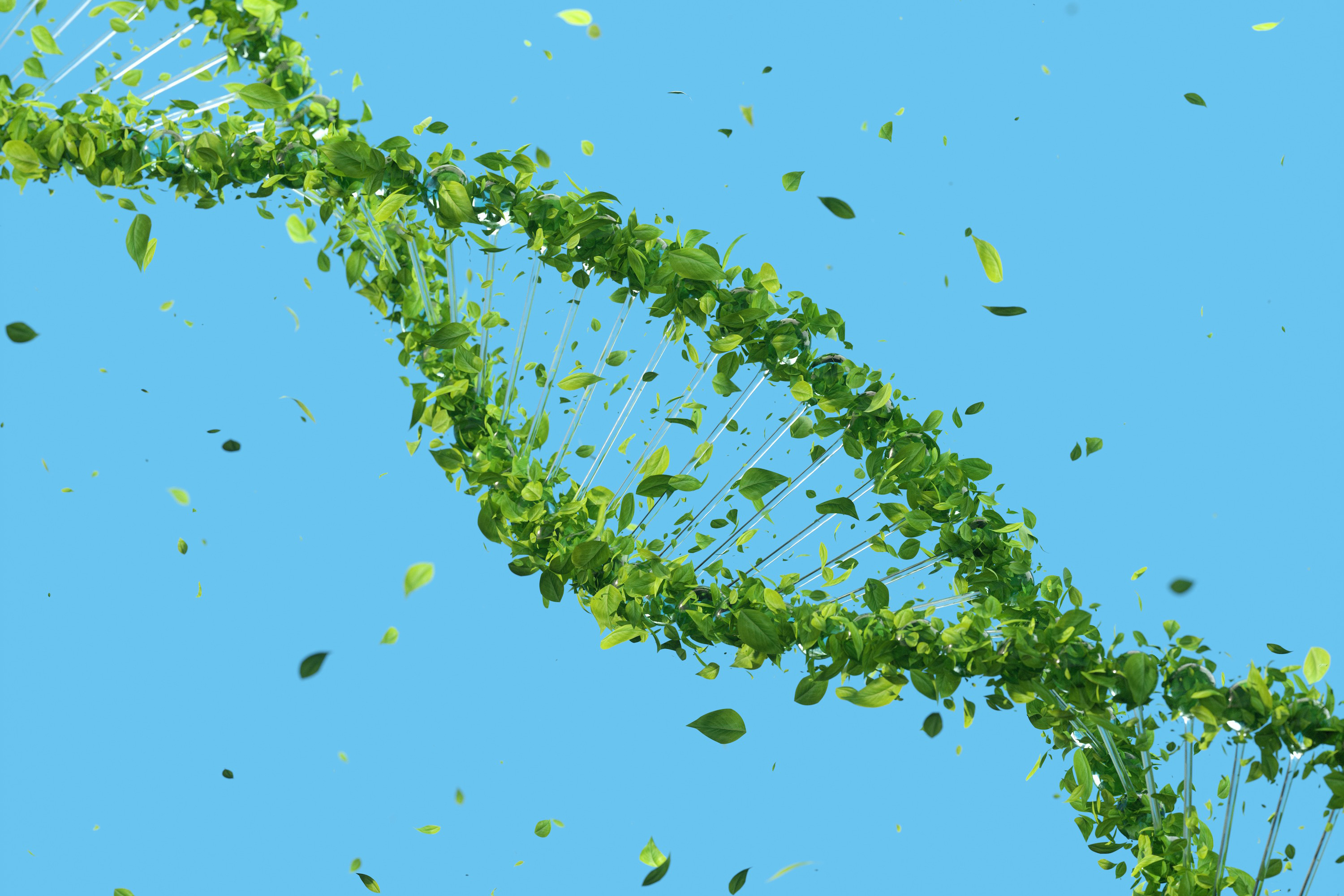
Definition: Was versteht man unter Gentherapie?
Als Gentherapie bezeichnet man die medizinische Methode der Einbringung von Nukleinsäuren (RNA oder DNA) in Körperzellen (Gentransfer), um deren Erbgut zu verändern und somit in erster Linie genetisch verursachte Krankheiten zu behandeln. Der potenzielle Einsatzbereich der Gentherapie ist jedoch noch umfangreicher und richtet sich auch auf die Behandlung von im Laufe des Lebens erworbenen Krankheiten wie Krebserkrankungen und Infektionskrankheiten. Da gentherapeutische Ansätze vorrangig auf Therapieformen abzielen, die nicht die Symptome einer Erkrankung, sondern die Krankheitsursache selbst behandeln (sogenannte Kausaltherapien), gehen sie zudem weit über die Möglichkeiten der meisten herkömmlichen Medikamente hinaus.
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Ansätzen der Gentherapie. Entweder wird eine Modifikation des Erbguts von Körperzellen (somatischen Zellen) vorgenommen, die sich auf die individuellen Patient*innen beschränken (somatische Gentherapie), oder es wird in das Erbgut von Keimzellen (Spermien oder Eizellen oder deren Vorstufen) eingegriffen, um das Erbgut von Nachkommen zu verändern (Keimbahntherapie). Da die Keimbahntherapie ein höheres Risiko unvorhersehbarer Konsequenzen birgt und dadurch umfassendere technische, aber auch ethische Bewertungen benötigt, wird der Gentransfer in Keimbahnzellen überwiegend abgelehnt und ist in Deutschland gemäß § 5 des Embryonenschutzgesetzes (ESchG) verboten. Alle Gentherapien, die bisher entwickelt und in klinischen Studien geprüft wurden, hatten die experimentelle Behandlung von schweren Krankheiten mittels somatischer Therapie zum Ziel.
Obzwar sich der Fokus bei gentherapeutischen Verfahren vorrangig auf eine postnatale Behandlung richtet, ist es theoretisch denkbar, somatische Gentherapien bereits vorgeburtlich anzuwenden. Das Konzept einer in-utero-Gentherapie eröffnet die therapeutische Option, schwerwiegende Erberkrankungen bereits im Embryostadium zu behandeln. Eine solche Behandlungsmethode birgt jedoch ebenfalls gewisse Risiken, insbesondere das einer unbeabsichtigten Übertragung des genmodifizierten Materials auf Zellen der Keimbahn (nichtintendierte Keimbahntransmission), und wurde bisher nur am Tiermodell erforscht.
Vorgehensweise: Wie funktionieren somatische Gentherapien?
Mit gentherapeutischen Verfahren können unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Das Einbringen der sogenannten Transgene in Gewebe oder Zellen kann direkt auf die Korrektur bzw. den Ersatz defekter oder fehlender Genfunktionen abzielen (Substitutionstherapie), womit in erster Linie monogenetische Erberkrankungen, d. h. Erkrankungen, die auf einem einzelnen Gendefekt beruhen, behandelt werden können. Zur Behandlung von Infektionskrankheiten oder Krebserkrankungen kann der Gentransfer aber auch der gezielten Verstärkung von Genfunktionen beispielsweise im Immunsystem dienen (Additionstherapie) und schließlich können gentherapeutische Verfahren zum Ziel haben, pathogene, d. h. krankmachende Genaktivitäten zu unterdrücken (Suppressionstherapie).
Der kritischste Schritt bei einer Gentherapie ist die effiziente Einbringung des gewünschten Gens bzw. des Werkzeugs zur Reparatur von Genen in die richtigen Zellen (engl.: gene delivery). Diese können entweder direkt im Organismus anvisiert werden (in vivo), oder es werden Zellen, beispielsweise Stammzellen aus dem Knochenmark, entnommen, die dann, nach genetischer Modifikation, wieder in den Organismus eingebracht werden (ex vivo).
Das einzubringende Material muss lange genug im Körper (z. B. in der Blutbahn) bestehen können, um an den richtigen Ort zu gelangen, ohne vorher von körpereigenen Abwehrmechanismen zerstört zu werden. Außerdem muss es sowohl die Membran der Zielzellen passieren, als auch in den Zellkern (Nukleus) gelangen können, in dem sich das Erbgut der Zelle befindet. Dazu werden sogenannte Vektoren verwendet, die als „Fähren” des genetischen Materials dienen.
Risiken
Erste Studien zu gentherapeutischen Verfahren am Menschen fanden Anfang der 1990er Jahre statt. Die Gentherapie gilt daher als ein relativ junges Gebiet der Forschung, zu dem im Vergleich zu anderen Behandlungsmethoden erst wenige klinische Studien durchgeführt wurden. Daher können bisher keine Langzeitfolgen von gentherapeutischen Behandlungen vorhergesagt werden. Diese Umstände stellen ein Risiko dar, das durch weitere intensive Forschung und klinische Studien eingegrenzt werden kann. Im Folgenden sollen grundlegende Risiken und Schwierigkeiten in der Verfahrensentwicklung kurz vorgestellt werden.
Bei Verfahren, bei denen das genetisch veränderte Material z. B. mithilfe von viralen Vektoren in das Genom der Zielzelle integriert wird, besteht das Risiko, dass es zu schädigenden Auswirkungen auf die DNA kommt (Genotoxizität). Bei der sogenannten Insertionsmutagenese, einer Sonderform der Genotoxizität, kann es durch die fehlerhafte Integration des therapeutischen Gens in das Genom zur Beeinträchtigung der Funktion von intakten Gensequenzen kommen. Dadurch kann beispielsweise die Kontrolle des normalen Zellwachstums gestört werden, wodurch Krebserkrankungen wie Leukämien entstehen.
Denkbar ist auch die akzidentielle Mobilisierung oder Freisetzung von infektiösen Genvektoren, die beispielsweise durch Körperflüssigkeiten oder bei der Anwendung an der behandelten Person ungewollt in die Umwelt gelangen könnten. Die Übertragung bzw. Ausbreitung kann entweder von einer Person auf eine andere Person (horizontale Transmission) stattfinden, oder die ungewollte Mobilisierung findet im Organismus selbst, von somatischen Zellen auf Zellen der Keimbahn (vertikale Transmission) statt. Durch die Entwicklung einer besseren Vektortechnologie kann diesen Risiken entgegengewirkt werden.
Die Gefahr einer Immunantwort des Körpers auf virale- als auch alternative Vektoren und genetisch veränderte Stamm- sowie Immunzellen birgt ein weiteres Risiko (Immunotoxizität). Immunreaktionen können die Elimination der genmodifizierten Zellen bis hin zu Organläsionen und schweren systemischen Reaktionen zur Folge haben und sind stark kontext- und krankheitsabhängig. Ein noch kaum erforschtes Risiko bei der Verfahrensentwicklung stellt außerdem die mögliche Arzneimittelwechselwirkung im Zuge der Verwendung unterschiedlicher Vektorsysteme oder anderer Wirkstoffe dar, bei der es beispielsweise zu immunologischen Kreuzreaktionen kommen könnte. Auch die Dosisfindung gestaltet sich schwierig, da sich Dosisvorhersagen aus dem Tiermodell nur bedingt auf den Menschen übertragen lassen.
Stand der Forschung und Aussichten
Die ersten Versuche, Krankheiten mithilfe von Gentherapien zu behandeln, lösten große Hoffnungen in zukünftige Therapiemöglichkeiten aus, die von einer regelrechten Euphorie begleitet waren. Im Jahr 1990 kam es zur ersten Anwendung einer Gentherapie am Menschen. Ein Forschungsteam von der University of Southern California in Los Angeles behandelte damals erfolgreich ein vierjähriges Mädchen, das an einer genetisch bedingten, schweren Störung des Immunsystems (engl.: severe combined immunodeficiency syndrome, SCID) litt. Grund für die Störung war ein defektes Gen, das eigentlich für den Bauplan des Enzyms Adenosin-Deaminase (ADA) verantwortlich ist. Für die Behandlung wurden der Patientin weiße Blutkörperchen entnommen, in die mithilfe von Retroviren intakte ADA-Gene eingebracht wurden. Nach der Rückführung der Zellen in den Körper kam es zu einer deutlichen Verbesserung ihres Zustands. Vollständig geheilt wurde die Krankheit durch die Therapie jedoch nicht. Zusätzlich zu der Gentherapie erhielten die Patient*innen der Studie deshalb Medikamente, die einen Ausgleich des Enzymmangels bewirken.
Die anfängliche Euphorie über die neuartigen Therapieansätze ebbte ab, als es 1999 im Rahmen einer von der University of Pennsylvania durchgeführten Versuchsreihe zum Tod des damals achtzehnjährigen Jesse Gelsinger kam. Gelsinger litt an einer angeborenen Störung des Harnstoffwechsels (Ornithin-Transcarbamylase-Defizit), die in schweren Fällen schon in jungen Jahren zum Tod führen kann. Obwohl die Symptome der Krankheit bei ihm weitgehend unter Kontrolle waren, nahm er freiwillig an der experimentellen Studie teil, die auf die Behebung des für die Krankheit verantwortlichen Enzymmangels abzielte. Wenige Tage nachdem ihm eine hohe Dosis von genmodifizierten Adenoviren in die Leber injiziert wurde, starb Gelsinger an einer Immunreaktion gegen die Viren.
Ungefähr zur gleichen Zeit, zwischen 1999 und 2000, führte ein Wissenschaftsteam am Hôpital Necker des Enfants Malades in Paris eine Gentherapie zur Behandlung der schweren X-chromosomalen kombinierten Immunschwäche (X-SCID) durch. Behandelt wurden insgesamt elf erkrankte Kinder, zehn von ihnen entwickelten daraufhin eine normale Immunabwehr. Bei der Therapie wurden den Patienten Stammzellen aus dem Knochenmark entnommen, in denen dann mittels Gentransfer der genetische Defekt korrigiert wurde. Die Behandlung von Stammzellen erschien zunächst besonders erfolgsversprechend. Ab 2002 wurde jedoch bekannt, dass vier der elf Jungen, wahrscheinlich aufgrund der eingesetzten Retroviren, an ungewöhnlichen Leukämien erkrankt waren. Eine ähnliche Studie, bei der es ebenfalls zu einer Leukämieerkrankung kam, wurde von einer britischen Arbeitsgruppe am Institute of Child Health in London durchgeführt.
Ohne Leukämiefälle verlief dagegen die Studie zur Behandlung der Immunschwäche ADA-SCID, durchgeführt von einem Forschungsteam des San Raffaele Telethon Institute in Mailand. Seit der Entwicklung dieser Gentherapie Anfang der 90er Jahre wurden mehr als zwanzig Kinder behandelt, von denen achtzehn ihre Immunschwäche überwunden haben, vierzehn davon ohne weitere Behandlung. Unter dem Namen Strimvelis wurde die Therapie 2016 in Europa zugelassen. Auch sie verfolgt einen Ansatz, bei dem Stammzellen aus dem Knochenmark mithilfe von viralen Vektoren ex vivo genetisch verändert werden.
Obwohl gentherapeutische Verfahren insgesamt noch keine etablierten Therapieoptionen darstellen, wurden vereinzelt bestimmte Gentherapeutika bereits auf den Markt gebracht. Zu der weltweit ersten Zulassung eines Gentherapeutikums kam es 2012 durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA). Zugelassen wurde das Arzneimittel Glybera, das zur Behandlung der äußerst seltenen Stoffwechselerkrankung Lipoprotein-Lipase-Defizienz (LPDP) dient. Zwar berichten fast alle bisherigen Patient*innen von einer gesteigerten Lebensqualität infolge der Behandlung, die Wirksamkeit der Therapie ist jedoch begrenzt, denn bisher führte sie noch zu keiner vollständigen Heilung. Da sich auf Grund der sehr hohen Kosten und einer geringen Anzahl möglicher Patient*innen die Herstellung des Arzneimittels nicht rentiert, beschloss der Hersteller des Medikaments UniQure 2017, die Zulassung in Europa nicht verlängern zu lassen.
Im Fokus medialer Aufmerksamkeit stand eine Studie zur Behandlung des Wiskott-Aldrich-Syndroms (WAS), die an der medizinischen Hochschule Hannover und der Kinderklinik der Universität München durchgeführt wurde. In den Jahren 2006 bis 2008 wurden mithilfe einer Gentherapie insgesamt neun Kinder behandelt, die an dem seltenen und schweren Immundefekt litten. Die Therapie schien zunächst erfolgreich zu verlaufen, wurde dann jedoch abgebrochen, als es nach mehr als zwei Jahren zu ersten Leukämiefällen kam. Inzwischen sind acht der neun Kinder an Leukämie erkrankt, drei von ihnen starben. Die übrigen erkrankten Kinder überlebten die Leukämie dank einer Stammzelltransplantation. Der Fall löste eine kontroverse Diskussion um die Anwendung neuer Therapieansätze und ihrer adäquaten Risiko-Nutzen-Abwägung aus. Kritiker*innen werfen dem leitenden Wissenschaftler in erster Linie vor, erkrankte Kinder mithilfe der experimentellen Gentherapie behandelt zu haben, die auch mithilfe der bisher praktizierten Methode einer allogenen Blutstammzelltransplantation hätten behandelt werden können.
Für mediale Aufmerksamkeit sorgte ab 2019 das Medikament Zolgensma, welches bei der Behandlung von Personen mit spinaler Muskelatrophie Typ 1 (SMA) eingesetzt wird und seit dem 1. Juli 2020 in der EU zugelassen ist. Die seltene Erberkrankung führt zur fortschreitenden Degeneration der Muskulatur und verläuft unbehandelt meist tödlich. Das Gentherapeutikum Zolgensma verspricht das Überleben der betroffenen Person zu ermöglichen. Es wird einmalig durch eine Infusion verabreicht und besitzt das Potential, die bestehenden, lebenslangen und über die Dauer kostenintensiven Therapieformen zu ersetzen. Im Zuge des sogenannten „value-based pricing“ setzte der Hersteller Avexis einen Wert von knapp zwei Millionen Euro fest, womit Zolgensma das damals teuerste Medikament auf dem Markt darstellte. Seit 2022 wird dieser Platz von dem, durch die US-Medikamentenaufsichtsbehörde FDA und mittlerweile auch von der EMA zugelassenen Medikament Hemgenix besetzt, ein einmaliges, gentherapeutisches Mittel für Erwachsene, die an Hämophilie B leiden. Das Medikament wurde mit 3,5 Millionen US-Dollar pro Einzel-Dosis angesetzt.
Trotz genannter Rückschläge häuften sich in den letzten Jahren vermehrt auch Erfolge in der Gentherapie-Forschung. Als neuartige Therapiemethode ist die Gentherapie deshalb immer noch von großem Interesse. Wie die beschriebenen Fälle zeigen, lassen sich Ansätze, die der Korrektur fehlerhafter Gene dienen, vorerst nur zur Behandlung monogenetischer Erkrankungen einsetzen. Erkrankungen, die durch komplexere genetische Schäden verursacht werden, können mit diesen Methoden der Gentherapie nicht ursächlich behandelt werden. Dennoch richtet sich die Aufmerksamkeit der Forschenden auch auf mögliche Gentherapien zur Behandlung von unterschiedlichen nicht-monogenetischen Erkrankungen, insbesondere Krebserkrankungen. Dabei werden jedoch andere Ansätze der Gentherapie verfolgt. Zum Beispiel können körpereigene Immunzellen genetisch so verändert werden, dass sie künstliche Rezeptoren an ihren Zelloberflächen tragen (CAR-T-Zellen), die spezifisch Krebszellen erkennen und angreifen. Seit mehreren Jahren werden Versuche mit CAR-T-Zellen durchgeführt. Erfolgsversprechende Versuche mit CRISPR/Cas9 an Zellkulturen und Tiermodellen lassen zudem auf Behandlungsmöglichkeiten von schweren Krankheiten wie AIDS hoffen. Die erste klinische Studie am Menschen mit CRISPR/Cas9 zur Behandlung von Krebs, von der man sich grundlegende Erkenntnisse bezüglich des therapeutischen Potentials der neu entwickelten Verfahren erhofft, startete Ende 2016.
Richtlinien der Bundesärztekammer
Bereits 1989 erarbeitete die Bundesärztekammer Richtlinien zur Gentherapie beim Menschen, die von einer strikten Trennung zwischen somatischer Gentherapie und Keimbahntherapie ausgehen. Während letztere „ausnahmslos abzulehnen” sei, werfe die somatische Gentherapie, da sich ihre Wirkung allein auf das behandelte Individuum begrenzt, keine wesentlich neuen ethischen und rechtlichen Probleme auf. Die Richtlinie führt eine Reihe von Bedingungen auf, bei deren Erfüllung die Gentherapie, verstanden „als Erweiterung der bisherigen Therapieformen”, als „ethisch vertretbar” anzusehen ist. Unter dem Titel „Richtlinien zum Gentransfer in menschliche Körperzellen” entstand 1995 eine überarbeitete und ergänzte Version, mit der die Etablierung der Kommission Somatische Gentherapie einherging. Kernaufgabe der Kommission war bis 2009 die fachlich-inhaltliche Begutachtung klinischer Studienvorhaben unter Verwendung von Gentransfer-Arzneimitteln. Unter anderem führte die Einführung einer gesetzlich vorgegebenen Beratungspflicht der zuständigen Ethikkommissionen für Gentransferstudien durch das zwölfte Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes aus dem Jahre 2004 dazu, dass die Kommissiontätigkeit zunächst ausgesetzt und die Kommission 2010 mit gleichzeitigem Außerkraftsetzen der Richtlinien aufgelöst wurde.
Gentherapeutische Behandlungen als „Klinische Prüfungen” und individuelle „Heilversuche”
Da die Sicherheitsrisiken, die mit der Entwicklung gentherapeutischer Verfahren einhergehen, größer sind als bei klassischen Arzneimitteln und solche Verfahren zudem nicht nur mit einem hohen wissenschaftlichen Interesse, sondern auch mit einem hohen technischen und organisatorischen Aufwand verbunden sind, fanden bis heute fast alle Behandlungen mit Gentherapeutika im Rahmen von „klinischen Prüfungen” im Sinne des § 4 Abs. 23 AMG statt. Anders als therapeutisch motivierte „Heilversuche”, die allein auf das Wohl der behandelten Person gerichtet sind, werden klinische Prüfungen von einer wissenschaftlichen Zwecksetzung begleitet (sogenannte „Therapiestudien”). Steht diese gar für sich allein, spricht man von „wissenschaftlichen Versuchen“ bzw. „Humanexperimenten”. Sämtliche klinische Prüfungen unterliegen den Anforderungen der §§ 40 ff. AMG und der §§ 7 ff. der deutschen Verordnung über die Anwendung der Guten Klinischen Praxis bei der Durchführung von klinischen Prüfungen mit Arzneimitteln zur Anwendung am Menschen (kurz: GCP-Verordnung). Die hier aufgestellten zwingenden Vorgaben decken verschiedenste Aspekte ab. Unter die objektive Legitimation fällt beispielsweise die „ärztliche Vertretbarkeit” der Risiken und Belastungen im Verhältnis zu dem Nutzen für die betroffene Person und zur Bedeutung für die Heilkunde (s. § 40 Abs. 1 S. 3 Nr. 2, 2a AMG). Die informierte Einwilligung (häufig auch engl.: informed consent) in die Teilnahme nach ordnungsgemäßer Aufklärung (§ 40 Abs. 1 S. 3 Nr. 3a, b i. V. m. Abs. 2, ggf. §§ 40 Abs. 4 Nr. 3, 41 Abs. 3 Nr. 2 AMG) sowie die Einwilligung in die Erhebung und Verwendung der personenbezogenen Daten (§ 40 Abs. 1 S. 3 Nr. 3c i. V. m. Abs. 2 Nr. 2a AMG) fallen unter die subjektive Legitimation. Schließlich wird die klinische Prüfung durch eine Reihe von Bedingungen, die sich an das Verfahren selbst richten, legitimiert. Dazu gehören u. a.: die Bewertung durch eine interdisziplinär besetzte Ethikkommission, der Nachweis einer geeigneten Einrichtung und geeigneten Prüfenden (§ 40 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 AMG) sowie die Genehmigung und Überwachung durch das BfArM. Zudem sind die Prüfenden dazu verpflichtet unerwartete Ereignisse unverzüglich mitzuteilen (§ 13 GCP-Verordnung) und die Ergebnisse zu veröffentlichen „unabhängig davon, ob sie günstig oder ungünstig sind” (§ 42b AMG).
Trotz der zum Teil detaillierten Vorgaben ist die rechtliche Beurteilung mit Schwierigkeiten und Unklarheiten verbunden. Beispielsweise ist die Risiko-Nutzen-Bewertung gentherapeutischer Verfahren aufgrund ihrer prognostischen Unberechenbarkeit besonders schwierig. Da den Individualrechten im Zweifel größeres Gewicht zukommt als dem in Aussicht stehenden wissenschaftlichen Fortschritt, lassen sich hochriskante Therapien, die zu nicht absehbaren und schwerwiegenden Nebenwirkungen führen können, allenfalls zur Behandlung schwer bzw. tödlich erkrankter Personen rechtfertigen. Dementsprechend plädiert auch der Weltärztebund in seiner Erklärung zur Gentechnologie für die strikte Nachrangigkeit gentherapeutischer Behandlungsmethoden: „wenn eine einfachere und sicherere Therapie möglich ist, sollte dieser der Vorzug gegeben werden” (Ziff. 7 der Erklärung der WMA 1987).
Die Einbettung gentherapeutischer Behandlungen in klinische Prüfungen ist von Rechts wegen nicht zwingend vorgegeben. Zwar hat sich sowohl die Kommission „Somatische Gentherapie” der Bundesärztekammer, als auch die Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für Grundsatzfragen der Genforschung gegen „individuelle Heilversuche” außerhalb klinischer Studien ausgesprochen, ein kategorisches Verbot sogenannter „Neulandtherapien” ist im deutschen Recht jedoch nicht vorgeschrieben. Verglichen mit Standardbehandlungen sind bei solchen „Neulandtherapien” (im Falle einer Medikamentengabe spricht man auch von einem „Compassionate-use”) die Anforderungen an Indikation, Behandlungsdurchführung und ärztliche Aufklärung jedoch bedeutend strenger. Zudem darf eine neue, experimentelle Behandlungsmethode laut der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von 2006 nur dann erfolgen, „wenn die verantwortliche medizinische Abwägung und ein Vergleich der zu erwartenden Vorteile dieser Methode und ihrer abzusehenden und zu vermutenden Nachteile mit der standardgemäßen Behandlung unter Berücksichtigung des Wohles des Patienten die Anwendung der neuen Methode rechtfertigt”. In diesem Sinne fällt die gewissenhafte Wahl der jeweils adäquaten Behandlungsmethode grundsätzlich unter die ärztliche Therapiefreiheit. Die behandelnde Person ist laut selbigem Rechtsspruch dabei jedoch stets in der Pflicht, die behandelte Person auf die Möglichkeit unbekannter Risiken hinzuweisen und über mögliche Gefahren aufzuklären. Denn auch wenn die neue Behandlungsmethode aus Sicht der ärztlichen Fachkraft alternativlos scheint, liegt es nach einer umfassenden Aufklärung im Ermessen der erkrankten Person der Behandlung zuzustimmen oder sie abzulehnen.
Verbot der Keimbahntherapie
Gemäß § 5 des Embryonenschutzgesetzes (ESchG) ist die gezielte künstliche Veränderung menschlicher Keimbahnzellen strikt verboten. Der Versuch oder die Durchführung einer Keimbahntherapie kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden. In den Erläuterungen des 1989 verabschiedeten Gesetzesentwurfs der Bundesregierung zum Embryonenschutzgesetz heißt es, dass der Gentransfer in menschliche Keimbahnzellen „wegen der irreversiblen Folgen der in der Experimentalphase zu erwartenden Fehlschläge – d. h. von nicht auszuschließenden schwersten Mißbildungen oder sonstigen Schäden – jedenfalls nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand nicht zu verantworten” sei. Zudem sei die Gefahr des Missbrauchs, „vor allem die Versuchung, die Methode des Gentransfers zu Zwecken der Menschenzüchtung zu verwenden”, nicht zu übersehen. Nichtintendierte Veränderungen der Erbinformation durch Impfungen, strahlen-, oder chemotherapeutische Behandlungen sind dagegen nicht strafbar (§5 Abs. 4 Nr. 3 ESchG). Zu Forschungszwecken sind Veränderungen der Erbinformation an Keimzellen ebenfalls zugelassen, sofern ausgeschlossen ist, dass diese zur Befruchtung verwendet werden (§5 Abs. 4 Nr. 1, Nr. 2 ESchG).
Angesichts des derzeitigen Forschungsstandes und der spezifischen Risiken der somatischen Gentherapie bezieht sich die ethische Beurteilung derselben vor allem auf die Problematik der Rahmenbedingungen klinischer Forschung mit gentherapeutischen Methoden. Sie zielt somit auf die Frage danach, wann Studien aufgenommen, unterbrochen und wiederbegonnen werden sollen und mit welchen Teilnehmenden diese durchzuführen sind.
Prinzipien der biomedizinischen Ethik
Eine Möglichkeit zur Benennung und Strukturierung ethischer Fragestellungen in Bezug auf somatische Gentherapie bieten vor diesem Hintergrund die vier Prinzipien der biomedizinischen Ethik von Tom L. Beauchamp und James F. Childress. Hinsichtlich einer Anwendung auf die spezifischen Herausforderungen der Gentherapie sind dabei u. a. folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Das Prinzip der Selbstbestimmung betrifft insbesondere die Einwilligung der zu behandelnden Person in den Eingriff auf Grundlage umfassender Information über die Ziele, die Durchführung, den erwarteten Nutzen sowie die Risiken und Nebenwirkungen des Eingriffs. Eine solche Information gestaltet sich jedoch gerade bei neuartigen Therapieformen, wie der Gentherapie, besonders schwierig, da eine konkrete Abschätzung des zu erwartenden Verlaufs der Behandlung im Vorfeld kaum möglich ist. Ein Legitimationsproblem entsteht zudem im Falle von nicht oder nur eingeschränkt einwilligungsfähigen sowie minderjährigen Patient*innen.
- Das Prinzip der Benefizienz betrifft den Individualnutzen, der für die behandelte Person durch den Eingriff entsteht. Untersucht wird dieser im Verhältnis zur Schwere der zu therapierenden Grunderkrankung, zu den theoretischen Erfolgsaussichten der Therapie, der Verfügbarkeit und dem Nutzen von Alternativbehandlungen sowie der mit der Therapie verbundenen Belastungen und Risiken. Eine adäquate Analyse potenzieller Resultate gentherapeutischer Interventionen steht vor der Schwierigkeit einer möglicherweise nicht hinreichend genauen Prognostizierbarkeit mittelbarer wie unmittelbarer Folgen des intendierten Eingriffs.
- Das Prinzip des Nichtschadens betrifft die Beurteilung und Abwägung der Risiken und Belastungen durch den Eingriff. Es lässt sich somit in erster Annäherung als negative Form des Benefizienzprinzips auffassen. Allerdings ist auf Grundlage einer Analyse von Belastungen und Risiko unabhängig vom Individualnutzen auch die Auffassung des Nichtschadensprinzips als eines eigenständigen Handlungsprinzips möglich. Bezogen auf die Gentherapie stellt sich insbesondere das Problem, dass die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß eines möglichen Schadens angesichts des derzeit noch stark experimentellen Charakters der Gentherapie kaum akkurat bestimmbar sind.
- Das Prinzip der Gerechtigkeit betrifft die Frage nach der gerechten Verteilung von Lasten und Nutzen. Hierbei werden die Ansprüche mehrerer Parteien in den Blick genommen, um den Sachverhalt in einem überindividuellen Rahmen zu betrachten. Eine zentrale Frage in Bezug auf die Gentherapie ist dabei die, ob der Erkenntnisgewinn mit der Aussicht auf künftige therapeutische Nutzung das womöglich relativ ungünstige Risiko-Nutzen-Verhältnis für die hier und jetzt betroffene Person rechtfertigen kann. Da die meisten gentherapeutischen Ansätze bisher der Behandlung von sehr seltenen Erkrankungen dienten, stellt sich zudem die Frage, inwieweit es vor dem Hintergrund gerechtigkeitstheoretischer Erwägungen begründbar ist, einen unter Umständen hohen Ressourcenaufwand zu betreiben, der nur einer kleinen Anzahl Betroffener zugutekäme.
Einen Ausweg aus der normativen Pattsituation zwischen den gleichrangigen Prinzipien bietet das Verbot der Instrumentalisierung von Personen. Dieses Prinzip fordert, dass eine Person niemals ausschließlich als Mittel für die Interessen Dritter – sei es die Gesellschaft, die Forschung oder andere Individuen – angesehen und in diesem Sinne benutzt werden darf. Vor diesem Hintergrund können Studien am Menschen, bei denen es ausschließlich um Toxizität geht, angesichts des hohen Risikoniveaus und der verbleibenden Unsicherheit als ethisch problematisch erscheinen. Hingegen können die Heilungsaussicht und das gleichzeitige Fehlen therapeutischer Alternativen – wie etwa im Fall eines individuellen Heilversuchs – Gentherapiestudien rechtfertigen.
Modelle einer Urteilsbildung vor dem Hintergrund einer Risiko-Nutzen-Abwägung
Nach dem derzeitigen Stand der Diskussion in Deutschland können vor dem Hintergrund einer Risiko-Nutzen-Abwägung im Hinblick auf die somatische Gentherapie verschiedene Modelle der ethischen Urteilsbildung unterschieden werden. Michael Fuchs schlägt dabei eine Differenzierung der folgenden vier Modelle vor:
Modell Risikovermeidung
Gemäß diesem Modell lässt sich vor dem Hintergrund der methodischen und theoretischen Ungewissheit sowie der daraus resultierenden Risiken, welche mit dem Konzept und den Zielen der somatischen Gentherapie verbunden sind, eine frühzeitige Verfolgung dieser Strategie aus ethischer Sicht nicht rechtfertigen. Da die somatische Gentherapie zudem keine forschungspolitisch dringliche Option darstelle, wird empfohlen, in eine methodologische Diskussion zurückzukehren, statt die ethische Entscheidung an die Einzelprotokollprüfung durch Ethikkommissionen zu binden. Als Vertreterin dieses Ansatzes wäre etwa Sigrid Graumann zu nennen.
Modell Arzneimittelzulassung
Die Kommission Somatische Gentherapie der Bundesärztekammer hat den Vorschlag erbracht, die somatische Gentherapie grundsätzlich als eine Weiterentwicklung gegenwärtiger therapeutischer Möglichkeiten zu betrachten („gene-therapy-as-extension view”). Dennoch wird angesichts des frühen Stadiums der Entwicklung dieses Ansatzes eine eingeschränkte Anwendung gentherapeutischer Verfahren empfohlen, die zunächst auf Personen mit schweren Krankheiten – insbesondere solchen, für deren Therapie derzeit keine geeigneten Mittel zu Verfügung stehen und die häufig tödlich verlaufen – begrenzt sein soll. Der Vorschlag fokussiert sich dabei auf klinische Prüfungen, da eine Therapieentwicklung rational nur durch Erkenntnisgewinn aufgrund der Anwendung an einer Reihe von erkrankten Personen möglich erscheint. Von individuellen Heilversuchen wird hingegen abgeraten.
Modell Gestufte Sicherheitsstrategie
Als ausreichend werden die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen für Gentherapien von der Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung der DFG erachtet. Der Kommission nach ist der Gentransfer als „neuartiges Arzneimittel” zu betrachten. Allerdings sollten virale Vektoren aufgrund der Risiken gentherapeutischer Verfahren nur bei schwerwiegender Erkrankung eingesetzt werden. Vektorsysteme, die keine dauerhaften Veränderungen hervorrufen, sollten nach umfangreichen Sicherheitstests auch bei nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen einsetzbar sein, da in diesen Fällen keine prinzipielle Unterscheidbarkeit von anderen pharmazeutischen Wirkstoffen vorliege. Des Weiteren spricht sich die Kommission für ein Verbot des Gendopings und des Einsatzes im kosmetischen Bereich im Falle der Verfügbarkeit sicherer Vektoren aus. Im Übrigen soll die versuchsweise Anwendung der somatischen Gentherapie dem Paradigma der klinischen Studie folgen.
Modell Kontrollierter Heilversuch
Ob eine Person in eine Gentherapiestudie aufgenommen wird, sollte der Projektgruppe „Ethik” der Klinischen Forschungsgruppe „Stammzelltransplantation der DFG” zufolge individuell auf Grundlage der therapeutischen Absicht und der individuellen Prognose entschieden werden. Zwar formulieren die Autor*innen ihre Überlegungen lediglich in Bezug auf die Anwendung des Verfahrens beim Wiskott-Aldrich-Syndrom (WAS), es kann allerdings angenommen werden, dass sich ihre Argumentation auch auf andere Gentherapieansätze übertragen lässt. Folglich könne angesichts der nicht abschließend kontrollierbaren Gefahren der Fortschritt der medizinischen Erkenntnis gegenüber dem individuellen Nutzen nur eine nachgeordnete Bedeutung haben. Dementsprechend wird im Falle eines schweren klinischen Krankheitsbildes und des Fehlens alternativer Behandlungsmöglichkeiten für die Möglichkeit eines individuellen Heilversuchs plädiert. Des Weiteren müsse die Anwendung, insbesondere bei nicht einwilligungsfähigen Patient*innen, gewissen Sicherheitsstandards unterworfen werden, welche weitgehend den Bestimmungen der Kommission Somatische Gentherapie entsprechen sollen.
Vergleichende Würdigung der Modelle
Jeder der genannten Ansätze weist sowohl stichhaltige Argumente als auch gewisse argumentative Schwachstellen auf und provoziert dadurch kritische Rückfragen.
Das Modell der Risikovermeidung berücksichtigt grundsätzliche Probleme des Konzeptes der Gentherapie angesichts der Rückschläge in der klinischen Erprobung. Fraglich ist allerdings, ob die daraus resultierenden Zweifel den Nachweisen der Wirksamkeit standhalten können, da auch die zahlreichen publizierten Resultate, die von erfolgreichen gentherapeutischen Behandlungen monogenetischer Erkrankungen berichten, bei der Bewertung der Wirksamkeit somatischer Gentherapien berücksichtigt werden sollten. Zudem müssen auch die theoretischen und technischen Ansätze zur Vermeidung unerwünschter Risiken in eine adäquate Beurteilung mit einbezogen werden.
Seit langem etabliert, differenziert und mit professionellen Elementen rechtsförmig ausgestattet ist hingegen das Modell der Arzneimittelzulassung. Seine Überzeugungskraft steht dabei in enger Korrelation zur grundsätzlichen Betrachtung der Gentherapie als einer bloß graduellen Weiterentwicklung konventioneller medikamentöser Therapien. Die Analogie zwischen experimenteller Gentherapie und Arzneimittelzulassung weist jedoch konzeptionelle Schwächen auf, die auch den ethischen Analogieschluss fraglich erscheinen lassen. Insbesondere gilt dies für eine Rechtfertigung der primären Zielsetzung des Erkenntnisgewinns angesichts des bekannten Risiko- und Gefahrenprofils sowie des Verbots einer Instrumentalisierung.
Das Modell der gestuften Sicherheitsstrategie beinhaltet ein komplexes Konzept, welches sowohl das Gefahrenpotential einer tiefgreifenden neuen Therapieform, wie die Gentherapie sie darstellt, anerkennt, als auch eine Strategie zu ihrer schrittweisen Etablierung entwirft. Es stellt sich allerdings die Frage, wie die Beurteilung der klinischen Anwendung im Vergleich zur Gesamtschlussfolgerung der Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung der DFG zu interpretieren ist. Die Schlussfolgerung beinhaltet die Empfehlung, Gentherapie mit retroviralen Vektoren, solange keine sicheren Viren vorliegen, ausschließlich bei Krankheiten ohne alternative therapeutische Option einzusetzen. Insbesondere beim Vergleich zwischen gentherapeutischen Studien unter Einsatz der vorhandenen Vektoren und der Knochenmarkstransplantation wird jedoch auf die schlechten Ergebnisse der Transplantation von Spendendengewebe hingewiesen. Daraus ließe sich schließen, dass die Gentherapie gerade für erkrankte Personen, für die keine geeignete gewebe-spendende Person verfügbar ist, trotz therapeutischer Alternative die bessere Option darstellen würde. Allerdings widerspräche ein solches Vorgehen der genannten Gesamtschlussfolgerung.
Im Fall des Modells des kontrollierten Heilversuchs bleibt abzuwägen, ob das zur Umsetzung geforderte hohe Niveau wissenschaftlicher und klinischer Praxis sowie eine Kontrolle durch autorisierte Ethikkommissionen gewährleistet werden kann. Zwar fokussiert dieses Modell das individuelle Patient*innenwohl, es erschwert damit jedoch zugleich die Durchführung klinischer Studien. Außerdem müsste geprüft werden, ob eine Legitimierung individueller Heilversuche dieser Art in der Gefahr stände, neue Grauzonen zu schaffen, insofern der potenzielle individuelle Erfolg als vorgeschobener Grund für ein riskantes experimentelles Verfahren nutzbar gemacht werden könnte.